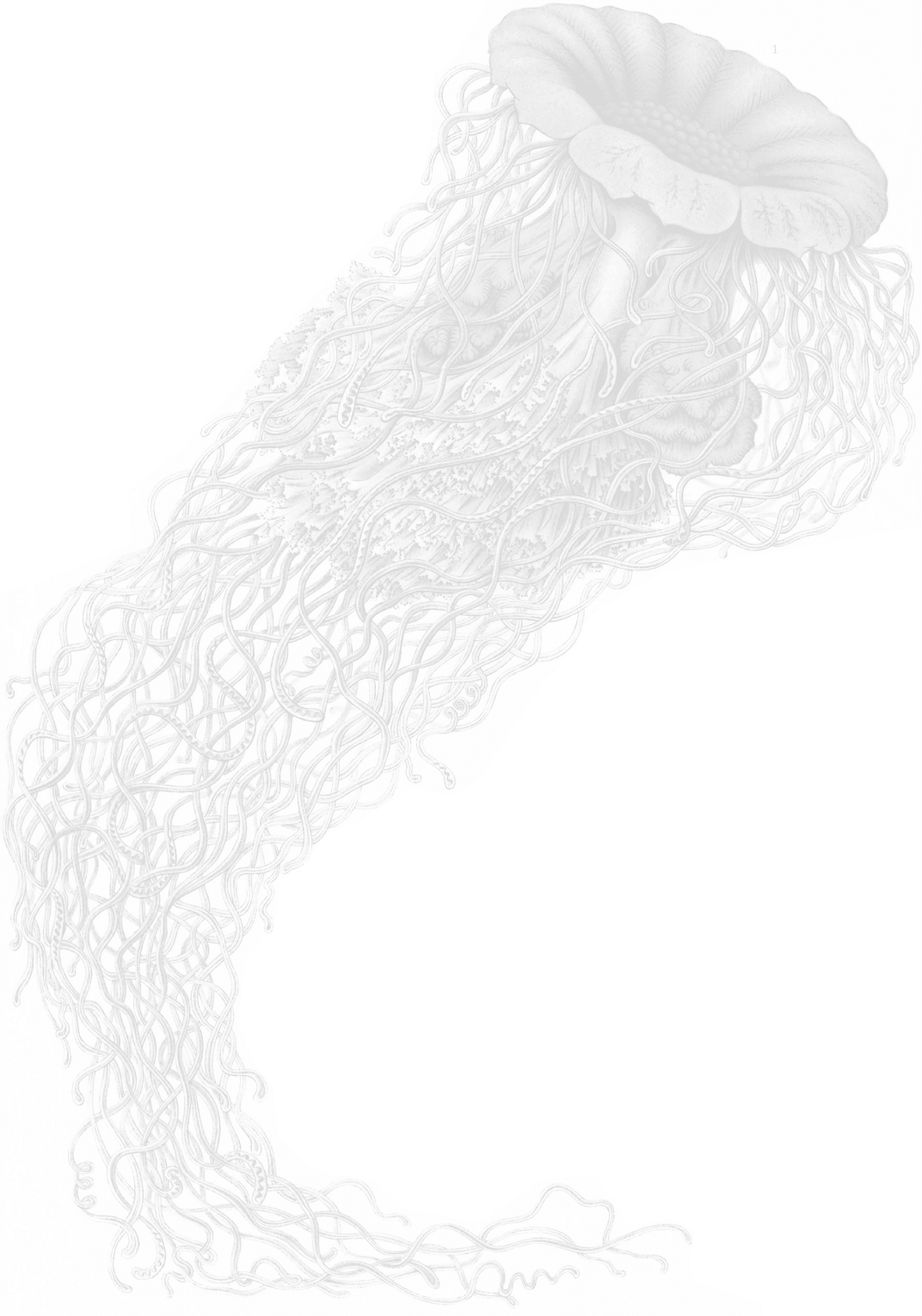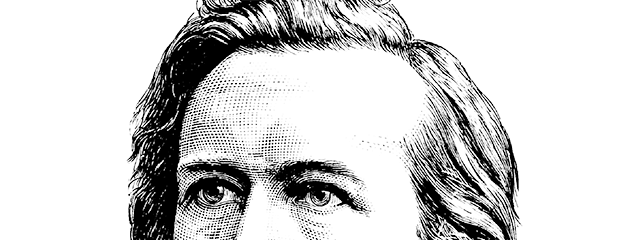Besonderheiten des Briefkorpus
Familienkorrespondenz
Bereits zu Lebzeiten hatte Ernst Haeckel an alle Familienmitglieder verfügt, seine Briefe aufzubewahren und ihm zu übergeben. Der Bitte ihres Sohnes folgend, hatte Haeckels Mutter Charlotte Auguste Henriette Haeckel, geb. Sethe (1799-1889) bei der Ende der 1870er Jahre unternommenen Durchsicht der den Eltern zugegangenen Briefe zwar viele vernichtet, jedoch die meisten Briefe von ihrem Sohn Ernst, seine Reiseberichte, Bücher, Zeichnungen und auch andere interessante Familienbriefe aufbewahrt und als Nachlass nach Jena bestimmt. Dementsprechend geschlossen präsentiert sich die Familienkorrespondenz innerhalb des gesamten Briefkorpus, die den Grundbaustein für Haeckels Biographie bildet und mit der die Print-Ausgabe daher auch eröffnet wurde.
Eine weitere Besonderheit der Familienkorrespondenz ist die bisweilen enorme Länge einzelner Briefe. Ernst Haeckel verfasste die Briefe in regelmäßigen Abständen, vor allem aber während seiner frühen Reisen explizit wie an Tagebuch statt und führte nur auf einzelnen Reisen noch separate Tagebücher. Insbesondere die Briefe aus Haeckels ersten Studienaufenthalten in Würzburg erhalten dadurch eine gewisse Intimität und spiegeln das selbstreflexive Ringens des noch jungen Ernst Haeckels, der sich mit wechselvollen akademischen, sozialen und politischen Verhältnissen konfrontiert sieht.
Vor allem die Reisebriefe spielten eine wichtige Rolle im familiären Umfeld. Sie zirkulierten als wichtiger Teil der Unterhaltungskultur im Kreise der Familie und gingen darüber hinaus häufig in Publikationen Haeckels ein. Dabei verschmelzen briefliche Mitteilungen, erkennbar an der Form (Anrede, Grußformel am Briefschluss), der direkten Ansprache der Adressaten und der dialogischen Bezugnahme auf zurückliegende Inhalte, mit tagebuchartigen Narrativen in einem Korrespondenzstück. Weitere Eigenheiten der Reisebriefe sind neben der aus Kostengründen regelmäßig praktizierten Kuvertfaltung auch die Defraudation politischer Zensur durch örtliche Behörden während politischer Unruhen in den bereisten Gebieten. So sind etwa Briefschreiber, die sich an den während des Zweiten Italienischen Unabhängigkeitskrieges 1859 in Neapel weilenden Haeckel wenden, angehalten, etwaige politisch brisante Nachrichten oder Stellungnahmen aus dem preußischen Ausland in die Mitte der Briefe zu platzieren und von trivialen Dialogen einzurahmen, um sie vor der regelmäßigen flüchtigen Einsichtnahme der Behörden durch Öffnung des Siegels zu schützen.
Ein untypischer Gelehrtenbriefwechsel
Neben der Überlieferungssituation mit verstreut liegenden Briefnachlässen hat das erkennbare Ungleichgewicht von Brief und Gegenbrief im Korrespondenzkorpus von Ernst Haeckel auch strukturelle Ursachen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde Ernst Haeckel in der Rezeption der von ihm selbst initiierten Popularisierung und Ideologisierung der Lebenswissenschaften (Vgl. u. a.: Ernst Haeckel: Die Welträthsel. Gemeinverständliche Studien über Monistische Philosophie. Bonn 1899, ders.: Die Lebenswunder. Gemeinverständliche Studien über Biologische Philosophie. Ergänzungsband zu dem Buche über die Welträthsel. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1904, sowie ders.: Der Kampf um den Entwicklungs-Gedanken. Drei Vorträge, gehalten am 14., 16. und 19. April 1905 im Saale der Sing-Akademie zu Berlin. Berlin: Reimer, 1905) zunehmend zur Symbolfigur und Projektionsfläche gleichermaßen. Dies schlägt sich sich vor allem in einem immensen Zuwachs an Korrespondenzen nieder. Die Struktur des überlieferten Briefkorpus ist daher in den späteren Jahren in hohem Maße von einseitiger, nichtdialogischer Kommunikation geprägt, die Ernst Haeckel aufgrund ihrer Anzahl überwiegend mit seriell gedruckten Schreiben beantwortete. Spätestens ab den 1890er Jahren überdeckt diese Form der Kommunikation zunehmend die traditionelle Gelehrten- und Familienkorrespondenz. Hierunter zählen in großer Anzahl Zuschriften, welche sowohl thematisch, als auch anhand der enormen Bandbreite der sozialen und kulturellen Herkunft der Autorenschaft die vielschichtige Rezeption Haeckels in ihrer gesamten sozialen, kulturellen, religiösen und politischen Wirkung greifbar machen.
Amtskorrespondenz
Einen großen Teil des Briefkorpus bilden amtliche Schriftstücke, die an Ernst Haeckel gerichtet waren oder von ihm selbst in amtlicher Funktion ausgingen und der Spezifik des amtlichen Schriftgutes folgen. Dieses unterlag traditionell bestimmten Vorschriften in Bezug auf äußere Form, Stil sowie Anrede-, Schluss- und Grußformeln (Kurialien), und es war abhängig von der Stellung der Korrespondenzpartner in der amtlichen Hierarchie. Korrespondenzstücke übergeordneter Instanzen wurden in der Regel als Reskripte und Dekrete ausgefertigt, die untergeordneten Instanzen schrieben an die oberen Instanzen in Form von Berichten. Erfolgte die Kommunikation der übergeordneten Instanz mehrstufig, und waren noch eine oder mehrere Instanzen in der Amtshierarchie dazwischengeschaltet, ging die Weisung zunächst als Reskript von Stufe zu Stufe und wurde dem Empfänger schließlich weisungsgemäß übermittelt. Da die Jenaer Universität und ihre Hochschullehrer keine Immediatstellung besaßen, sondern nur an die Universitätskuratel berichteten, die wiederum mit den Ministerien der Erhalterstaaten kommunizierte, war das auch fast immer der Fall, wenn Weisungen des Weimarer Staatsministeriums an Ernst Haeckel übermittelt werden sollten. Ging ein solches Reskript beim Kurator ein, erließ dieser ein Notifikationsdekret an Haeckel, häufig in Form eines auf dem Blatt des Reskripts oder einer Abschrift niedergeschriebenen knappen Kuratelbeschlusses. In der Dokumentation erscheinen daher oftmals Dekrete der Universitätskuratoren, die lediglich der Mitteilung von Ministerialreskripten dienten. Manche Kuratoren übermittelten die Ministerialreskripte nicht im Originaltext, sondern formulierten eigene, in der Form persönlicher Briefe gehaltene Weisungsschreiben, was bei den Kuratoren Moritz Seebeck (1805-1884) und später auch bei Max Vollert (1851-1935) fast durchgängig der Fall war. Direkte Dekrete des Weimarer Staatsministeriums an Ernst Haeckel ergingen dann, wenn es sich um Weisungen handelte, die er in seiner Eigenschaft als Direktor des Großherzoglichen Zoologischen Museums, also als weimarischer Beamter, erhielt, so z. B. im Zusammenhang mit den Bauangelegenheiten des Zoologischen Museums. Die Kommunikation in der Amtshierarchie der Universität war ebenfalls detailliert geregelt und erfolgte bis zum Ersten Weltkrieg noch in den traditionellen Formen, die schon im 18. Jahrhundert gebräuchlich waren. Gutachten einzelner Professoren in Fakultätsangelegenheiten wie z. B. Promotionen, Habilitationen oder Denominationen zur Besetzung neuer oder vakanter Stellen, wurden, sofern nicht ein Fakultätsconsess darüber beschloss, als Initialvoten auf den Missiven des Dekans niedergeschrieben oder in besonderen Begleitschreiben erstattet. Über die Promotionsverfahren wurden lediglich Semesterberichte erstattet, da diese in der Fakultät abgeschlossen wurden. Bei Beschlüssen, die der Sanktion des Senats oder der Ministerien bedurften wie z. B. bei Habilitationen oder Denominationen, erstellte der Dekan aufgrund des Gutachtens des zuständigen Fachexperten und der Voten der anderen Fakultätsmitglieder einen Antragsbericht an den Prorektor und den Senat, wobei häufig der Wortlaut des zugrundeliegenden Gutachtens übernommen wurde. Nach der Beratung der Fakultätsanträge im Senat, in minder wichtigen Angelegenheiten auch durch Abstimmung per Missiv, berichtete der Prorektor das befürwortende oder ablehnende Senatsvotum unter Beifügung des Fakultätsberichtes an den Universitätskurator. Dieser leitete es, versehen mit seiner eigenen, oftmals ausschlaggebenden berichtlichen Stellungnahme, an die Staatsministerien der vier Erhalterstaaten weiter. Nun folgte ein aufwendiger Kommunikationsprozess zwischen den Staatsministerien, in dem jedes Ministerium jedem anderen seine Entscheidung kommunizierte. Wenn die Übereinstimmung aller vier Ministerien konstatiert war, erließ das großherzogliche Staatsministerium im Namen aller Erhalter entsprechende Reskripte an den Universitätskurator, der diese wiederum dem Prorektor notifizierte. Daraufhin ergingen in jedem Einzelfall Prorektoratsmissive an den Senat und nach deren Bestätigung Notifikationsdekrete an die Dekane, denen meist Abschriften der Ministerialreskripte beigefügt waren. Den Dekanen oblag es dann, die Fakultätsmitglieder sowie die Habilitanden oder andere Betroffene über die Entscheidung in Kenntnis zu setzen. Schreiben von fürstlichen Personen an Ernst Haeckel ergingen, sofern es sich nicht um Urkunden wie z. B. bei Ordensverleihungen und Ehrungen handelte, als Handschreiben, d. h. von Schreiberhand gefertigte Briefe mit eigenhändiger Unterschrift, oder sie wurden, was bei Dankschreiben für von Haeckel übersandte Publikationen häufig der Fall war, im fürstlichen Auftrag von Adjutanten, Hofmarschällen oder anderen Personen des Hofes ausgefertigt.