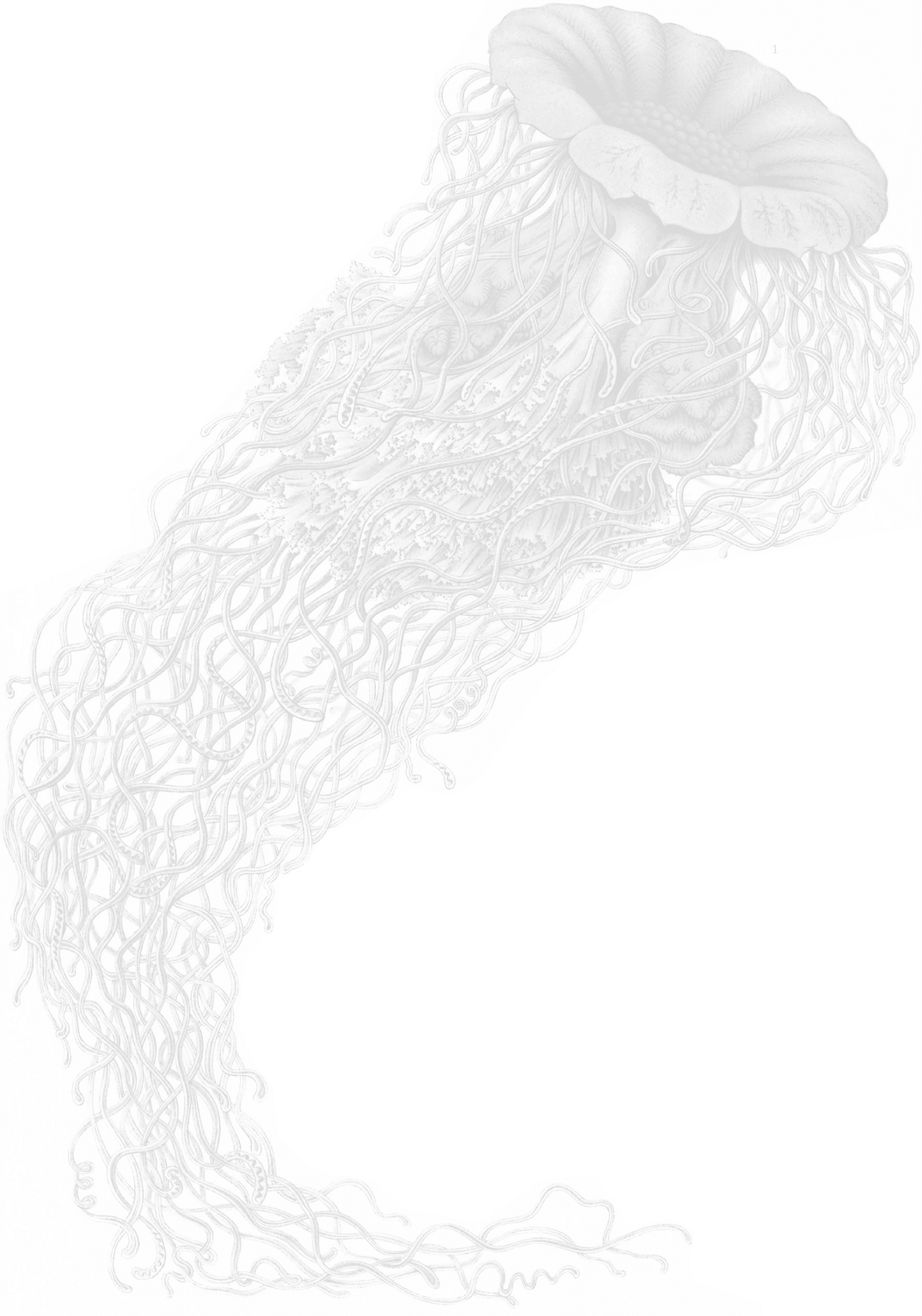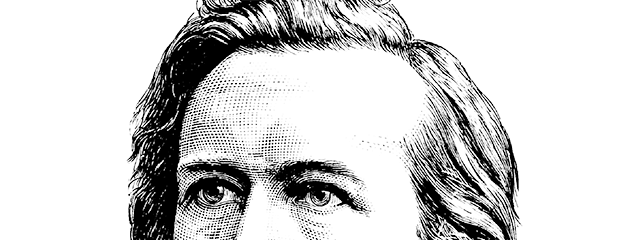Editionsgeschichte
Vorläufer
Die ersten Korrespondenzen Ernst Haeckels wurden bereits zu dessen Lebzeiten und mit seiner Unterstützung veröffentlicht. Umfangreichere Briefausgaben wurden durch seine Nachlassverwalter ab 1921 besorgt. Sie enthalten jedoch kaum Gegenbriefe und bilden damit keinen Briefwechsel im eigentlichen Sinne ab. Ebenfalls in diese Zeit fällt auch die Aufnahme von Briefen Ernst Haeckels in Anthologien hervorragender Wissenschaftler. Jene frühen Ausgaben verfolgten mehr oder weniger die hagiographische Absicht, dem Naturforscher Haeckel einen Platz in der Reihe der „großen Männer der Wissenschaftsgeschichte“ zu sichern. (Vgl. u.a.: Wilhelm Bölsche: Ernst Haeckel. Ein Lebensbild. Bd. 8, Ernst Haeckel. Dresden und Leipzig 1900. aus der Reihe: Gustav Diercks (Hg.): Männer der Zeit. Lebensbilder hervorragender Persönlichkeiten der Gegenwart und der jüngsten Vergangenheit.) Dieser Absicht folgend wurden die Brieftexte zum Teil sehr stark gekürzt, an den Sprachgebrauch ihrer Zeit angeglichen und nicht selten zensiert, z.T. sogar im Wortlaut verändert. Gemeinsam ist diesen frühen Briefausgaben außerdem, dass sie trotz hoher Verbreitung fast alle ohne textkritische Apparate, Kommentare oder Indices auskommen.
Thematische Auswahleditionen nach heutigen Standards sind hauptsächlich in jüngerer Zeit, vor allem im Rahmen der Ernst-Haeckel-Haus-Studien erstellt worden. (Vgl. u.a.: Rosemarie Nöthlich (Hg.): Ernst Haeckel – Wilhelm Bölsche. Briefwechsel (1887-1919). (Ernst-Haeckel-Haus-Studien; 6/1), Berlin 2002🔗, sowie dies. (Hg.): Ernst Haeckel – Wilhelm Bölsche. Kommentarband zum Briefwechsel (1887-1919). (Ernst-Haeckel-Haus-Studien; 6/2), Berlin 2006.)🔗